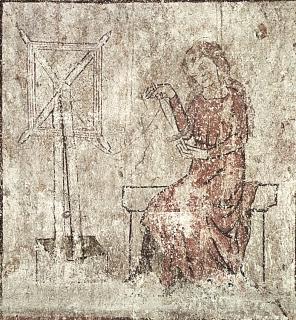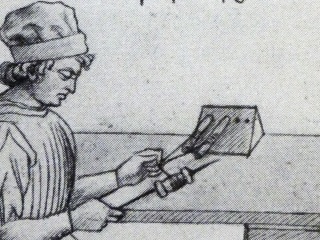Die
Rohseide musste zur Weiterverarbeitung von der Haspel auf Spulen
gewickelt werden. Diesen Arbeitsgang findet man vermutlich auch auf
einer der Abbildungen in Haus Kunkel wieder. Auch der Text über den Fresken, "Side spul ich ane nid" - Seide spul ich ohne Neid(5), deutet darauf hin.
Auch die Tatsache, dass das Mädchen eine Spule in
der Hand hält, die einer Handspindel sehr ähnlich ist, lässt mich
vermuten, dass hier eher Rohseide verarbeitet und aufgespult wird.
Daher haben wir nach diesem Vorbild unsere Seidenhaspel
entwickelt. Als Spule diente mir eine meiner
Handspindeln. Für die ersten Versuche war ich ganz zufrieden. Ich bin
bei meinem Spinnwirtel geblieben, allerdings haben wir dünnere Stäbe
gewählt. Ein weiteres Problem war anfangs die Wickeltechnik, oft hatte
ich das Problem, dass sich zu viele Schlaufen auf einmal von dem
Spindelstab beim Zwirnen abzogen. Aber mit der Zeit habe ich die
Technik verbessert und eine gewisse Routine im Spulen entwickelt.
So brauche ich nun für eine Spule mit 30 m gleichmäßig aufgewickelter
Seide etwa 6 Minuten.

Verzwirnen/Verspinnen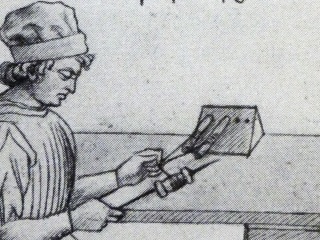
Federzeichnung "Trattato dell' Arte della Lana", Codex Riccardianus, Florenz (Abb. 2)
Leider
bin ich hier auf das Problem gestoßen, dass das Bild mit Seide
verzwirnen überschrieben ist, aber "Trattato dell' Arte della Lana"
(Wolle) erwähnt wird. In dem gleichen Codex gibt es auch die
Abhandlung "Trattato dell' Arte della Seta" (Seide), ich kann im Moment
nicht sagen, wo der Fehler liegt. Da ich das Verzwirnen von Wolle
anders kenne, bin ich hier zunächst einmal davon ausgegangen, dass es
sich tatsächlich um Seide handeln könnte.
Die
Rohseidenfäden bestanden aus meist 5-8 Einzelfasern. Um eine bessere
Haltbarkeit zu erreichen, wurden mehrere Rohseidenfäden miteinander
verzwirnt. Bisher habe ich nur diese eine Italienische Abbildung
gefunden. Unser Nachbau ist dem annähernd Nachempfunden. Von
mehreren Spulen/Spindelstäben werden die Rohseidenfäden vorsichtig
abgezogen und erhalten dabei einen ganz leichten Drall. Zum Aufwickeln
habe ich anfangs jedoch keine Spule wie auf der Abbildung zu sehen
genommen, sondern einen ganz normalen Spindelstab. Nach längerem
Ausprobieren ist es mir dann gelungen, eine Wickeltechnik zu finden,
mit der die Rohseide tatsächlich einen leichten Drall erhält. Mit ein
bisschen Übung gelingt mir das mittlerweile auch recht zügig und ich
kann den Drall durch abspulen und neu aufwickeln noch verstärken.
Spannend finde ich, dass diese Arbeit vom Ablauf her sehr gut zu
der Abbildung passt. Auf dem unteren Bild ist das Spulenkästchen
zu sehen mit der dazugehörigen Spule.


Für
Italien habe ich wie oben schon erwähnt den
Beruf des Seidenzwirners gefunden, der dort übrigens vorwiegend von
Männern ausgeübt wurde(7). In Köln gab es die Seidenspinnerinnen, hier
kann ich nur vermuten, ob es sich um denselben Arbeitsgang handelt,
oder ob die Seidenabfälle, die Kokonreste, bzw. die sogenannte
Schappeseide weiterverarbeitet wurde. Bisher habe ich darüber nur sehr
wenig gefunden, in Paris und Oberitalien wurden anscheinend diese Reste
verarbeitet.
Im unteren Bildteil eine Spule mit verzwirrntem Seidengarn.

Entbasten
Nach längerem Experimentieren mit verschiedenen Zutaten, die
historisch überliefert sind, bin ich so nach und nach auch mit dem
Entbasten der Seide zufrieden. Dabei wird der Seidenleim, das
sogenannte Sericin von den Fasern entfernt. Sie werden weich und
bekommen ihre weiße, extrem glänzende Beschaffenheit. So vorbereitet
kann das Garn dann gefärbt werden und ist damit für die Textilarbeit
fertig gestellt.

Gefärbtes Seidengarn
Grob gerechnet benötige ich im Moment für 50m fertiges Garn ca.
vier bis fünf Stunden und halte am Schluss vielleicht zwei Gramm Material in
der Hand. Alleine die Garnherstellung ist somit per Hand schon eine recht aufwendige
Geschichte, aber das Ergebnis kann sich definitiv sehen lassen, wie meine
kleine „Schatzkiste“ zeigt.
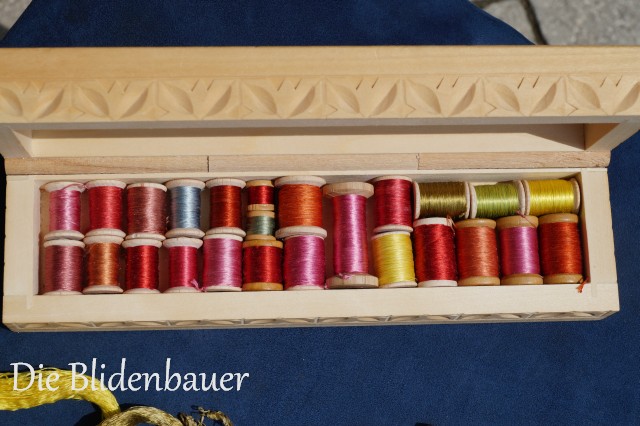
Mein kleines Wisby-Seidenprojekt 2019
Während der Veranstaltung habe ich mal ein wenig experimentiert
und von den Kokons angefangen Seidengarn hergestellt. Erste Erfahrung,
Seide ist irgendwie kein draußen Projekt. Aber immerhin habe ich
tatsächlich ein wenig fertig gefärbtes Garn erhalten und bin um einige
Erfahrungen reicher.






Die verschiedenen Arbeitsschritte:
Auskochen und abhaspeln der Kokons
Spulen der Seidenfaser
Verzwirnen
Einnähen in Leinensäckchen und Entbasten
Reseda auskochen
Färben
Hier also nun mein Wisby-Seidengarn:
Weitere Färbe-Experimente 2020