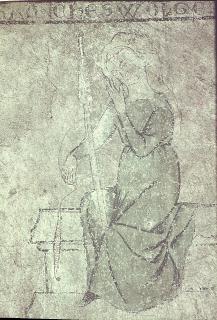Die
Leinenherstellung im Spätmittelalter

Beschäftigt man sich intensiv
mit der Herstellung von Leinen, scheint es auf den ersten Blick sehr
einfach, etwas darüber herauszufinden, gibt es doch hunderte von
Büchern zu diesem Thema. An die Grenzen stößt man dann allerdings sehr
schnell, wenn man zeitlich weiter zurückgeht. Der größte Teil der
Literatur über die Leinenherstellung und die dazugehörigen Werkzeuge
stammt aus den letzten drei Jahrhunderten, davor wird es schon
schwieriger und für das Mittelalter musste ich die Nachweise über die
Gerätschaften zur Fasergewinnung mühsam zusammensuchen.
Mittlerweile
kann ich aber sämtliche Arbeitsgänge mit den dazugehörigen Werkzeugen,
die wir bis ins letzte Jahrhundert kennen, wenigstens bis ins
Mittelalter zurückverfolgen. Darüber ist ein umfangreicher
Fachaufsatz unter dem Titel „Die Röteteiche in Spenge-Bardüttingdorf“
entstanden, der im „Historisches Jahrbuch für den Kreis Herford 2017“
ISBN 978-3-7395-1024-8 mit einer Vielzahl von Abbildungen veröffentlicht wurde. An dieser
Stelle noch mein ganz herzlicher Dank an den Herausgeber und die
Verlagsmitarbeiter.
Leider ist es mir auf unserer Homepage nur
eingeschränkt möglich, alle originalen Abbildungen zu zeigen, da die
Bildrechte zum Teil ausschließlich für den Fachartikel galten. Daher
habe ich hier in dem kurzen Bericht über die Leinenherstellung einige
Repliken abgebildet, die mein Mann gefertigt hat.
Desweiteren ist mittlerweile auch ein Fachaufsatz in englischer Sprache im EXARC-Journal erschienen unter dem Titel "Flax Fibre Extraction Techniques in the Late Middle Ages".
Hierüber freue ich mich besonders, da es sich um eine internationales
Netzwerk von Fachleuten handelt, die für archäologischen
Freilichtmuseen sowie in experimenteller Archäologie und alter
Technologie tätig sind.
Zu
den am häufigsten verwendeten Geweben im Mittelalter gehörte neben der
Wolle das Leinen. Vorwiegend in Natur oder weiß gebleicht, fand es
Verwendung für die Untergewandung, Kopfbedeckungen sowie Tisch- und
Bettwäsche. Dabei waren die Weber oft spezialisiert, so gab es zum Beispiel Ziechenweber, die
Leinen nur für Bettzeug herstellten oder Schleierweber.
Auch
als Futterstoff taucht Leinen immer wieder auf, genauso wie es für
militärische Kleidung, zum Beispiel Gambesons verwendet wurde.
Wesentlich
seltener sind Belege für Obergewandung. Ich habe bisher nur wenige
Hinweise in der Sekundärliteratur gefunden, denen ich allerdings noch nicht
nachgehen konnte.
Nach allem, was ich bisher über Leinen gelesen habe, halte ich es aber
für wahrscheinlich, dass auch für Obergewandung Leinen durchaus
Verwendung fand, wenn auch lange nicht in dem Maße wie Wolle.
Was
es zudem sehr schwer macht, Leinen mit Funden zu belegen ist die
Tatsache, dass die Pflanzenfaser im Gegensatz zu Wolle in saurem Boden
verwittert. Da wir überwiegend saure Böden haben, gibt es leider auch
kaum erhaltene Bodenfunde von Leinen.
Da sich unter
dem Begriff Leinen Gewebe sowohl aus Flachs, als auch Hanf verbergen
kann, macht es die Recherche nicht immer einfach. Öfter bin ich dabei
auf Widersprüche gestoßen. Hatte ich anfangs das Augenmerk
ausschließlich auf Flachs gerichtet, bin ich nun immer mehr der
Überzeugung, dass Hanf viel häufiger verwendet wurde, als bisher
allgemein Erwähnung fand. So wurde zum Beispiel in Proben von
Siegelschnüren, die aus der Bodenseeregion stammten festgestellt,
dass bis Mitte des 13. Jahrhunderts dort die
Hanffasern
überwogen, danach erst die Flachsfaser. Dennoch
liegt der Schwerpunkt auch bei mir noch mehr auf der Gewinnung von
Fasern aus Flachs.
Geschichte
Anhand von Samenfunden geht man davon aus, dass der Flachs
bereits vor etwa 10000 Jahren in Mesopotamien, dem Heutigen Irak und
der Türkei angebaut wurde. In Europa deuten Funde von Samenkapseln in
Pfahlbausiedlungen in der Schweiz auf eine Kultivierung vor knapp 5000
Jahren hin. (1)
Auch der Hanf scheint ursprünglich aus Mesopotamien
zu stammen und aus einer zweiten asiatischen Region, aus China. Funde,
die auf eine Verarbeitung und Anbau in diesen Regionen hindeuten,
wurden auf ein Alter von 12000 Jahren datiert.
Hinweise zur
Nutzung der Fasern sind allerdings wesentlich älter. 2007/2008 hat ein
Forscherteam in einer Höhle in Georgien bearbeitete Flachsfasern gefunden, die auf
ein Alter von 34000 Jahren datiert wurden. Man geht hier von der Nutzung einer
Wildform vom Flachs aus. (2)
Im Mittelalter wurde der Flachs
vorwiegend in Mitteleuropa angebaut. Dabei zog sich die Anbauregion von
England bis ins Baltikum und nach Russland. Deutschland besaß drei
Hauptanbauzentren, die Bodenseeregion/Schwaben,
Westfalen/Südniedersachsen und Sachsen/Schlesien/Pommern. Durch den
Aufstieg der Städte ging die Tuchherstellung aus dem ländlichen Bereich
im 12./13. Jahrhundert, in die vorwiegend gewerbliche Produktion über.
Dabei blieb die Herstellung des Rohmaterials bis zum gesponnenen Garn
weiter hauptsächlich im Ländlichen, während die ländlichen Weber mit
städtischen immer mehr in Konkurrenz kamen. Allerdings wäre ohne die
ländliche Weberei Leinen als Massenprodukt nicht möglich gewesen.
Leinenweber hatten dabei oft nicht den Stand und das Ansehen, wie die
Wollweber. So gab es ab dem Spätmittelalter des Öfteren Zunftverbote
und Leinenweber gehörten in einigen Orten zum unehrlichen Gewerbe.
Dieses Phänomen verbreitete sich dabei eher im Norden. In vielen
Städten in Süddeutschland genossen die Leinenweber ein besseres Ansehen.
Verarbeitung
Da die
Verarbeitung identisch ist, können die meisten Arbeitsgänge für Flachs
und Hanf als gleich angenommen werden. Dabei verarbeitet sich
der
Hanf schwerer und die Gerätschaften sollten stabiler ausfallen.
Von der Flachspflanze, aber mehr noch von der Verarbeitung
hing ab, wie fein und damit hochwertig die hergestellten Tuche waren.
Der
erste Schritt war daher schon der Anbau, eine wichtige Voraussetzung
für einen guten Wuchs der Pflanze. Allerdings würde es doch den Rahmen
sprengen, darauf genauer einzugehen. Daher möchte ich hier nur die
Verarbeitung beschreiben. Um die komplette Faserlänge
auszunutzen, wurde der Flachs nicht geschnitten, sondern mit den
Wurzeln aus der Erde gezogen, das sogenannte Raufen. Dies geschah etwa
100 Tage nach der Aussaat, wenn die Stängel die ersten Blätter
verloren, aber die Samenkapseln noch geschlossen waren. Danach wurde er
auf dem Feld getrocknet. Über den Flachs habe ich gelesen, dass je
jünger die Pflanze geerntet wird (grüner Leinen), desto feiner ist die
Faser. Allerdings wird die Verarbeitung auch schwieriger, da sich die
Fasern schwerer aus dem Bast lösen und empfindlicher sind.
Um die komplette Faserlänge
auszunutzen, wurde der Flachs nicht geschnitten, sondern mit den
Wurzeln aus der Erde gezogen, das sogenannte Raufen. Dies geschah etwa
100 Tage nach der Aussaat, wenn die Stängel die ersten Blätter
verloren, aber die Samenkapseln noch geschlossen waren. Danach wurde er
auf dem Feld getrocknet. Über den Flachs habe ich gelesen, dass je
jünger die Pflanze geerntet wird (grüner Leinen), desto feiner ist die
Faser. Allerdings wird die Verarbeitung auch schwieriger, da sich die
Fasern schwerer aus dem Bast lösen und empfindlicher sind.


Hier ist der geraufte Flachs in Kapellen aufgestellt. Nach zehn Tagen ist er getrocknet und
hat eine goldbraune Farbe bekommen.
Über
den Hanf habe ich bisher leider nur zwei gegensätzliche
Berichte gefunden. Einmal die Aussage, dass er geschnitten wird, da der
untere Teil samt Wurzeln keine gute Faser mehr gibt, dann dass auch er
gerauft wird. Daher werde ich mich mit diesem Thema noch mehr
auseinandersetzen müssen. Auch wurde scheinbar ein Unterschied zwischen
männlicher und weiblicher Pflanze gemacht, da diese von der Faser her
unterschiedlich reiften und daher in einigen Regionen zu
unterschiedlichen Terminen geerntet wurden.(3)
Riffeln
Das
sogenannte Riffeln diente zur Ernte der Leinsamen. Dabei wurde der getrocknete
Flachs über Riffelkämme gezogen, um die Samenkapseln abzustreifen. Es
gibt Holzfunde von diesen Werkzeugen über ganz Europa verteilt, zum
Beispiel aus der Wurt Elisenhof, in Novgorod oder Bergen, die diesem
Arbeitsgang zugeordnet werden.
Auf dem Foto ist ein Kamm aus Eisen,
der wahrscheinlich aus dem 18. Jahrhundert stammt, den ich zu
Demonstrationszwecken nutze. Aus Ungarn ist ein Fundstück aus Eisen aus
dem 13. Jahrhundert bekannt. Ein Nachbau eines Holzkammes ist bei uns
in
Planung.
 In einem Buch aus dem letzten Jahrhundert habe ich noch
eine andere Art der Samenernte
kennengelernt.(4) In
einer Region im Elbe-Weser- Dreieck wurden die
Flachsstängel gegen eine niedrige Holzwand (Ausschlagebock)
ausgeschlagen. Wie effektiv diese Methode ist, kann ich nicht
sagen.
Es bleibt offen, ob diese Anwendung im Mittelalter in einigen Regionen
auch vorkam. Da kein Werkzeug nötig ist, vereinfacht es die Sache
natürlich.
In einem Buch aus dem letzten Jahrhundert habe ich noch
eine andere Art der Samenernte
kennengelernt.(4) In
einer Region im Elbe-Weser- Dreieck wurden die
Flachsstängel gegen eine niedrige Holzwand (Ausschlagebock)
ausgeschlagen. Wie effektiv diese Methode ist, kann ich nicht
sagen.
Es bleibt offen, ob diese Anwendung im Mittelalter in einigen Regionen
auch vorkam. Da kein Werkzeug nötig ist, vereinfacht es die Sache
natürlich.
Die Fotos von der Ernte und dem Riffeln sind in Stade 2014 im
Freilichtmuseum auf der Insel entstanden. Vielen Dank dabei an Frau
Barbara Drewes, die die Gartenakademie dort geleitet und die schönen
Bilder gemacht hat. Leider handelt es sich hier noch um Ölleinen, der
kürzer wächst als der Faserleinen. Zum Ausprobieren hatte es mir aber
gereicht.

Hier ist meine erste Ernte Faserlein getrocknet und geriffelt zu sehen.
Rösten/Rotten
Die ringförmig um den Pflanzenkern angelegten Faserbündel
wurden durch das Rösten/Rotten vom Stängel gelöst. Dabei zersetzten
Bakterien (Wasserröste) oder Pilze (Tauröste) den Pflanzenleim, der die
Fasern umgibt. Bei der Wasserröste wurde die Pflanze komplett in Wasser
eingetaucht, in die sogenannten Rottgruben gelegt, während bei der
Tauröste der Flachs auf Wiesen oder abgeernteten Feldern ausgebreitet
und durch Tau und Regen feucht gehalten wurde.(6) Dabei dauerte die
Tauröste länger, war wetterabhängiger und lieferte oft auch ein
ungleichmäßiges Ergebnis. Trotzdem bin ich auch hier auf
Widersprüchliches gestoßen, welches Verfahren die bessere Faser
lieferte. Herrschten bei beiden Verfahren jeweils die optimalsten
Bedingungen vor, gab es anscheinend keine großen Qualitätsunterschiede.

Der Flachs in der Weiterverarbeitung. Mit einem kleinen Teil habe ich den Versuch der Wasserröste in einer
kleinen Wanne gemacht. Den größeren
Anteil des Flachses habe ich zur Tauröste auf dem Rasen ausgebreitet.


Hier
das fertige Ergebnis meiner ersten Wasser- und der Tauröste 2014. Ich war
doch sehr angetan, dass auch ohne Vorkenntnissse verwertbares
Material zustande kam. Natürlich habe ich aber noch nicht die volle
Ausbeute erreicht, die eine gute Röste gebracht hätte. So war ich sehr
unsicher, wann beide Röstverfahren zu beenden waren und habe hier
sicherlich nicht den optimalen Zeitpunkt erwischt. Auch lag die
Tauröste im Oktober/November aus, was vom Wetter her wahrscheinlich
schon zu kalt war.

Wahrscheinlich
mehr Glück als Erfahrung hat mir 2016 eine sehr schöne Ernte gebracht.
Den Flachs hatte ich relativ früh geerntet. Tatsächlich ließ er sich
nach der Wasserröste schwerer aus dem Bast lösen, vor allen an den
Spitzen. Dafür wurde ich mit einer feinen, hell glänzenden Faser belohnt.
2020 hatte ich eine sehr gute Ernte mit hochgewachsenem Flachs und
wollte ihn daher komplett auf der Museumsinsel verarbeiten. Dabei habe
ich auch die Gelegenheit genutzt, einmal eine Wasserröste in fließendem
Gewässer zu machen und einen kleinen der Ernte in ein Netz eingebunden,
beschwert mit einem Stein elf Tage im Burggraben liegen gelassen. Der
Flachs war anschließend voller Modder, aber nach dem Ausspülen wieder
hell und die Fasern hatten sich gut gelöst.
Die
weitere Verarbeitung des Flachsstrohs fiel in den Spätherbst und Winter. Ein
Lied aus dem 13. Jahrhundert von Neidhardt, das ich gefunden habe,
trägt den Titel „Winterlied 8“. Ebenso sind die Bilder über die
Flachsverarbeitung von Albrecht Glockendon aus den Jahren 1526 und 1535
und Abbildungen des flämischen Malers Simon Bening um 1515 den
Kalenderblättern November zugeordnet.
 Darren
Darren
Nach
dem Rösten/Rotten musste der Flachs erneut getrocknet werden. Dies
geschah, indem man ihn wieder auf den Feldern bündelweise
zusammenstellte. Es wurde anscheinend auch die Möglichkeit genutzt, den
Flachs in
Backöfen zu trocknen. Aus der Neuzeit gibt es mehrere Berichte, dass
Stadtbrände dadurch ausgelöst wurden. In wie weit dieses Verfahren im
Mittelalter
bereits Verwendung fand, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Es gibt
Berichte für über spezielle Darröfen und -gruben, deren Tradition bis
in das
frühe Mittelalter zurückreichen soll (6 u.7), in denen die
Flachsstängel
durch dörren über dem Feuer härter gemacht wurden, damit sich die
Holzteile noch besser lösten.
Der Flachs lässt sich
tatsächlich viel leichter von dem Bast entfernen. Die Beschreibung,
dass die äußere Hülle nach dem Darren wie Glas
zerspringt, kann ich bestätigen. Wichtig ist
hierbei
noch, dass der Flachs dann auch gleich nach dem Trocknen gebrochen
wird, da sich die Wirkung sonst wieder aufhebt.
Boken
Bis
in 20. Jahrhundert ist dieser Arbeitsgang immer wieder anzutreffen,
allerdings nicht überall. Aus dem letzten Jahrhundert habe
ich
zwei Fotos gefunden, auf dem ein Mann vor einem Holzklotz steht und mit
einem Holzknüppel (in Nordrhein-Westfalen Bülter genannt) den Flachs
bearbeitet.(8)  Mein
Holzknüppel ähnelt diesem und einem Fund aus Bergen (Bryggen),
der
ebenfalls diesem Arbeitsgang zugeordnet und auf das Spätmittelalter
datiert wurde. In einem Text von Gottfried von Neifen taucht
der
Satz „si kann beidiu dehsen unde swingen“, Lied II, 5 1-3 auf.(9)
Hierbei frage ich mich,
ob das Wort „deshen“ auch für dreschen/brechen stehen könnte
und damit
diesen Arbeitsgang beschreibt. Da die Entstehungszeit und Verbreitung der Flachsbreche, wie wir sie heute
kennen nicht ganz sicher scheint, besteht für mich durchaus
die Möglichkeit, dass die Stängel nur durch das Klopfen gebrochen wurden. Ich habe das selber einmal ausprobiert
und es funktioniert tatsächlich. Allerdings muss man hier einschränken,
dass die Stiele hauptsächlich längs aufgespalten werden und die Arbeit
so wesentlich länger dauert. Auch ist nicht auszuschließen, dass
dadurch die Faser leidet.
In der Neuzeit wurde das Boken meist als Vorarbeit zum
Brechen angewendet.
Mein
Holzknüppel ähnelt diesem und einem Fund aus Bergen (Bryggen),
der
ebenfalls diesem Arbeitsgang zugeordnet und auf das Spätmittelalter
datiert wurde. In einem Text von Gottfried von Neifen taucht
der
Satz „si kann beidiu dehsen unde swingen“, Lied II, 5 1-3 auf.(9)
Hierbei frage ich mich,
ob das Wort „deshen“ auch für dreschen/brechen stehen könnte
und damit
diesen Arbeitsgang beschreibt. Da die Entstehungszeit und Verbreitung der Flachsbreche, wie wir sie heute
kennen nicht ganz sicher scheint, besteht für mich durchaus
die Möglichkeit, dass die Stängel nur durch das Klopfen gebrochen wurden. Ich habe das selber einmal ausprobiert
und es funktioniert tatsächlich. Allerdings muss man hier einschränken,
dass die Stiele hauptsächlich längs aufgespalten werden und die Arbeit
so wesentlich länger dauert. Auch ist nicht auszuschließen, dass
dadurch die Faser leidet.
In der Neuzeit wurde das Boken meist als Vorarbeit zum
Brechen angewendet.
Brechen
Die
Flachsbreche scheint terminlich etwas schwieriger einzuordnen zu sein.
In einer Dissertation (10) und mehreren späteren Berichten fand ich die
Aussagen, dass „die Flachsbreche nicht vor 1300 in Holland entwickelt
wurde“. Leider haben die
Autoren keine näheren Angaben gemacht und keinerlei Hinweise zur Herkunft dieser Aussage gegeben. Daher kann ich
auch nicht sagen, wie zuverlässig diese ist. Die frühesten Abbildungen,
die ich von solchen Brechen kenne, stammen von Mitte des 15. und Anfang des 16.
Jahrhunderts.
Allerdings gibt es noch Funde von Holzfragmenten, die den oberen
Teil der Flachsbreche darstellen könnten und viel früher einzuordnen
sind. Fragmente eines Fundes aus der Siedlung Feddersen Wierde/
Norddeutschland liegen zeitlich vor 1000 (11) und in dem
Archäologischen
Landesmuseum Brandenburg ist ein Exponat ausgestellt, das der
Slawenzeit zwischen 600 und 1200 zugeschrieben wird. Ein weiteres
Fragment wurde in Neu Pansow gefunden und dürfte aus dem unteren Teil
einer Breche stammen. Erstaunlich, dass dieses mittels der
Radiokarbondatierung schon auf 400 n.Chr. zu datieren war.(12) Diese
drei Fundstücke scheinen zu belegen, dass die Flachsbreche weit
vor dem 13.Jahrhundert genutzt wurde.


Feiertagschristus Pfarrkirche Saak, Österreich
1465
Albrecht Glockendon, Nürnberg 1526 (Abb.1)
Ausschnitt (Abb.2)

Wir haben uns entschieden, unsere Flachsbreche nach den
Abbildungen zu bauen.
Der Flachs wurde gebrochen, um die äußere holzige Schicht zu
zerstören und einen Großteil, die Schäben, davon auszuschlagen.
Im Haus
Kunkel sind die sogenannten Weberfresken erhalten geblieben, welche die
Hanf/Flachs- und Seidenverarbeitung zu Beginn des 14. Jahrhunderts
zeigen. Auf der ersten Abbildung ist zu sehen, wie Hanf mit der Hand
gebrochen wird. Ich habe dies einmal
mit Flachs ausprobiert. Auch das
funktioniert, ist aber wenig effektiv und sehr langwierig.
Interessant
war, dass ich in einem
anderen Buch eine Beschreibung darüber fand, wie noch im späten 19.
Jahrhundert
in Norditalien der Hanf mit der Hand aufgeschleißt und der Bast von
jedem Stängel einzeln abgelöst wurde (13), was dann
tatsächlich zu der Abbildung im Haus Kunkel passen
könnte. Ansonsten war mir bisher auch beim Hanf
nur bekannt gewesen, dass er gebrochen wurde, genauso wie der Flachs.
Video vom Brechen. (Vielen Dank an Maria Neijman)

Weberfresken Haus Kunkel, Konstanz, um 1320, Entbasten und Schwingen
(Abb.3)
Schwingen
Das
Flachsschwingen wurde wie schon erwähnt bereits im 13. Jahrhundert
besungen. Auch auf den Fresken von Haus Kunkel ist eine Frau
wahrscheinlich beim Flachsschwingen zu sehen. In der Überschrift steht
das Wort "Thesens", dass hier anscheinend mit dem Schwingen in
Verbindung gebracht wird.(14)
Allerdings
war mein Versuch, die Fasern über den Oberschenkel zu legen und dann zu
schwingen nicht sehr ergiebig. Von daher kann ich mir noch nicht ganz
vorstellen, wie das so funktioniert haben soll oder ob mir nur die
Übung fehlt. Auf den Bildern von Glockendon kann man
ebenfalls eine Flachsschwingerin sehen. Jedoch ist dort
und
auch auf einem Holzschnitt um 1580 nur eine Art Tisch oder
Klotz
abgebildet, auf
der die Schwingerin den Flachs legt. Bei einem Besuch des Heideklosters
Wienhausen habe ich auf zwei dort ausgestellten Wandteppichen, datiert
auf Ende des 14./Anfang des 15. Jahrhunderts und der zweite um 1480,
ebenfalls Abbildungen vom Schwingen gefunden. Hier zeigt sich der
Schwingstock schon so, wie wir
ihn bis in das letzte
Jahrhundert fast unverändert kennen, ebenso wie bei den
flämischen Zeichnungen, die allerdings erst um 1515 entstanden sind. Unsere Konstruktion wurde in Anlehnung an die Abbildungen auf den Wandteppichen nachgebaut.
Etwas, das ich persönlich noch interessant finde ist die Tatsache, dass
auf den ausgestellten Teppichen in Wienhausen neben den biblischen
Darstellungen die Flachsbearbeitung zu finden ist. Ein direkter Bezug
zu den anderen Bildmotiven besteht anscheinend nicht und ich frage
mich, welche Bedeutung die Leinenverarbeitung dort besaß, wenn gerade
diese hervorgehoben wurde.
 Belegt ist ebenfalls unser Schwingschwert. Das Original haben wir bei der
Ausstellung „Aufbruch in die Gotik“ in Magdeburg gesehen, es war eine
Leihgabe
des Braunschweiger Museums und wurde auf um 1250 datiert. Wir haben das
Schwert nach den angegebenen
Maßen im Ausstellungskatalog ebenfalls aus Rotbuche nachgebaut.
Belegt ist ebenfalls unser Schwingschwert. Das Original haben wir bei der
Ausstellung „Aufbruch in die Gotik“ in Magdeburg gesehen, es war eine
Leihgabe
des Braunschweiger Museums und wurde auf um 1250 datiert. Wir haben das
Schwert nach den angegebenen
Maßen im Ausstellungskatalog ebenfalls aus Rotbuche nachgebaut.
Bei dem Schwingen werden die restlichen Schäben entfernt und
die Fasern aufgelockert.
Video vom Schwingen. (Vielen Dank an Maria Neijman)
Ribben
Ein
weiterer Arbeitsgang, der sich wenigstens vom Mittelalter ins letzte
Jahrhundert erhalten hat, jedoch nicht überall praktiziert wurde, ist das Ribben.
Während vor gut hundert Jahren dazu als Hilfsmittel ein
sogenanntes
Ribbeisen verwendet wurde, scheint auf der Abbildung von Haus Kunkel
diese Arbeit des Glattstreichens nur mit der Hand gemacht
worden zu sein, was so allerdings schwer nachzuvollziehen ist und ich mir auch noch nicht ganz vorstellen kann.
Weberfresken Haus Kunkel, Konstanz, um 1320
Ausschnitt Ribben (Abb.6)

Hier benutze ich ein Ribbeisen.
Das
Original habe ich an einer Statue an der Kathedrale von Chartres
entdeckt, die auf 1250 datiert ist. Erstaunt bin ich auch hier, wie
lange dieses Werkzeug anscheinend unverändert in Gebrauch war.
Durch
das Ribben wurden die Fasern nicht nur geglättet, sondern man erhielt
dadurch sehr feine und seidige Fasern (15). In einigen Regionen hat man
gleich nach dem Brechen geribbt und das Schwingen weggelassen. Ich habe
es ausprobiert. Allerdings ist es etwas mühsamer und die Schäben
schwerer zu entfernen.
Video vom Ribben. (Vielen Dank an Maria Neijman)
Hecheln
Auch
hier fand ich unter den Fresken von Haus Kunkel wieder eine Abbildung
zu einer weiteren Verarbeitung des Hanfes/Flachses. Wenn ich das Bild
mit meiner Bauernhechel auf dem rechten Foto vergleiche, die vermutlich
Ende des
19. Jahrhunderts entstand, ist die Ähnlichkeit doch schon verblüffend.
Es zeugt meiner Meinung nach ebenfalls davon, wie wenig sich ein großer
Teil der
bäuerlichen Gerätschaften bis zum Industriezeitalter verändert
haben. Zudem gibt es noch als weiteren Beleg den relativ gut
erhaltenen Fund einer Hechel auf der Burg Bommersheim/Hochtaunus,
der zeitlich vor 1382 einzuordnen ist.
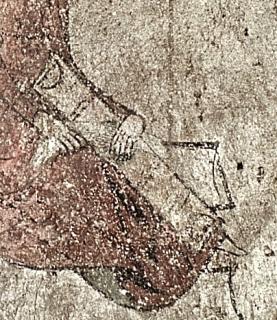

Weberfresken Haus Kunkel, Konstanz, um 1320
Ausschnitt Hechel (Abb.4)
Video vom Hecheln. (Vielen Dank an Maria Neijman)
Eine
Buchillustration aus Frankreich, erste Hälfte 15. Jahrhunderts
entstanden, deutet auch auf
diesen Arbeitsgang hin.
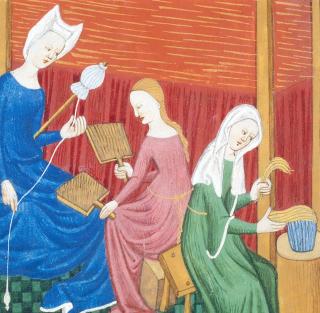
Giovanni Boccaccio, De claris mulieribus
Frankreich etwa 1440, Ausschnitt (Abb.5)
Auf dem Bild
wird neben dem Weben das Spinnen und Kadieren
von Wolle gezeigt. Die dritte Frau auf der Abbildung scheint allerdings
Flachs zu verarbeiten. Sie sitzt vor einem runden Holzstamm, auf dem
mehrere Reihen langer Zinken stehen und ist gerade dabei, lange Fasern
darüber zuziehen. Ich gehe hier eher von einer Flachshechel
aus, da die Wollkämme sonst immer als
Paar und nur ein- bis zweireihig gezeigt werden.

Unsere Hechel
ist sehr einfach gehalten. Sinnvoll erscheint mir, später noch eine
feinere
dazu zu nehmen. Die erste grobe, um die letzten Holzteile und kurzen
Fasern zu entfernen und die feine, um den Flachs zu glätten und
auszukämmen.

 Meine erste selbstgewonnene Faser 2015 von der Aussaat angefangen.
Eigentlich sollte ein Faseranteil von etwa zehn Prozent vom Flachsstroh
herauskommen. Bei mir war es wohl maximal die Hälfte gewesen.
Dennoch war ich sehr zufrieden mit dem ersten Ergebnis.
Meine erste selbstgewonnene Faser 2015 von der Aussaat angefangen.
Eigentlich sollte ein Faseranteil von etwa zehn Prozent vom Flachsstroh
herauskommen. Bei mir war es wohl maximal die Hälfte gewesen.
Dennoch war ich sehr zufrieden mit dem ersten Ergebnis.
Spinnen Abbildungen
über Spinnrocken
habe ich öfter gefunden. Dabei gibt es einmal die Möglichkeit, dass die
Spinnerin den Rocken unter den Arm geklemmt hat. Ich habe diese Technik
bisher nur mit Wolle ausprobiert und stelle es mir bei den langen
Flachsfasern schwieriger vor. Dann gibt es auch immer wieder Bilder von
Rocken, die einen Standfuß haben. Unser Rocken entstand nach
Abbildungen zum Beispiel von 1402 aus Giovanni Boccaccio, Des claires
et nobles femmes und um 1500 aus einem Stundenbuch aus Holland.
Abbildungen
über Spinnrocken
habe ich öfter gefunden. Dabei gibt es einmal die Möglichkeit, dass die
Spinnerin den Rocken unter den Arm geklemmt hat. Ich habe diese Technik
bisher nur mit Wolle ausprobiert und stelle es mir bei den langen
Flachsfasern schwieriger vor. Dann gibt es auch immer wieder Bilder von
Rocken, die einen Standfuß haben. Unser Rocken entstand nach
Abbildungen zum Beispiel von 1402 aus Giovanni Boccaccio, Des claires
et nobles femmes und um 1500 aus einem Stundenbuch aus Holland.

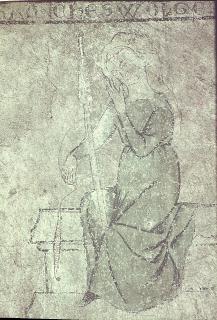 Weberfresken Haus Kunkel, Konstanz, um 1320
Spinnrocken (Abb.7)
Weberfresken Haus Kunkel, Konstanz, um 1320
Spinnrocken (Abb.7)
Stundenbuch Holland um
1500 (Abb.8)
Gefärbtes Leinen:
Eine weitverbreitete Meinung, auf die ich immer wieder gestoßen
bin, dass Leinen nicht, bzw. nur sehr schwer färbbar ist und es daher
kaum farbiges Leinen gegeben hat. Das lässt sich allerdings mit
zahlreichen schriftlichen Belegen, sowie erhaltenen Textilien
widerlegen. Gerade blau gefärbtes Leinen taucht immer wieder auf, zum
Beispiel als Futterstoff für klerikale Gewänder oder erwähnt in alten
Abrechnungen aus Konstanz und Köln. So ist Köln für den Export des
Kogelers bekannt gewesen, eines blauen Leines. In den Abrechnungen von Konstanz taucht
ebenfalls oft blau gefärbtes Leinen auf, das in Köperbindungen
hergestellt und zu Bett- und Tischwäsche weiterverarbeitet wurde.
Auch
andere Färbungen waren möglich gewesen, zumindest bin ich über
schriftliche Erwähnungen von gelb, grün und rot gestoßen, zum Beispiel
in den Farbkundebüchern von H. Schweppe und E. Ploss(16). Zudem gibt es
erhaltene Textilien in rosa und braun. Die Blaufärbung überwog aber bei
weitem, genauso wie die Schwarzfärbung in der Bodenseeregion im
Spätmittelalter. Dabei wurde der Stoff zunächst blau und dann mit
Eichengalläpfeln schwarz übergefärbt. Die Häufigkeit der Blaufärbung
lag wohl nicht zuletzt daran, dass der blaue Farbstoff Indigo ein
sogenannter Küpenfarbstoff ist, der vereinfacht gesagt als Farbe nicht
in die Faser eindringt, sondern aufliegt und damit das Leinen leichter
zu färben macht, als ein Farbstoff, der über die Färberflotte in die
Faser eindringt.
Eine Aussage von H. Schweppe sei hier noch erwähnt,
die sich mit meinen Recherchen weitestgehend deckt. Er erwähnt, dass
die Leinenfärberei im Mittelalter in den Kinderschuhen steckte(17).
Tatsächlich habe ich bisher die meisten Belege erst ab dem Spätmittelalter gefunden.
Blau- und Schwarzfärbung scheinen da allerdings schon weit ausgereift
zu sein, braun vor allem bei Stickgarn taucht auch häufiger auf.
Dagegen sind rote und gelbe Färbungen eher vereinzelt erwähnt und über
grün habe ich bisher nur zwei Mal etwas gefunden. Erst ab dem 16.
Jahrhundert gibt es scheinbar mehr Hinweise auf buntes Leinen.
Abschließend:
Dies
hier ist zunächst nur ein grober Abriss über die Leinenherstellung im
Spätmittelalter. Ich habe noch Abbildungen von Gerätschaften,
die
ich bisher nicht weiter verfolgt habe. Was für mich die Recherche
erschwert ist die Tatsache, dass ich bei einigen Beschreibungen von
Funden nicht immer sicher bin, ob sie wirklich den angegebenen
Tätigkeiten zugeordnet werden können. So stolpere ich immer wieder über
Kämme mit sehr großen Zinken, die als Hecheln eingeordnet wurden. Die
feinen Flachsfasern durch diese groben Kämme zu ziehen ist allerdings
wenig effektiv, gerade wenn es darum geht, möglichst feine Fasern zu
bekommen.
Einiges an den vorindustriellen Werkzeugen hat
sich bis in das Mittelalter zurückverfolgen lassen und gerade die
Bilder mit den dazugehörigen Beschreibungen aus dem Haus Kunkel haben
mir bei meiner Recherche sehr geholfen. Alles in allem hat sich die
Verarbeitung von Flachsfasern über die Jahrhunderte kaum wesentlich
verändert.
Die
Entwicklung des Spinnrades und des Webstuhls wurden hier nicht weiter
berücksichtigt, da mein Schwerpunkt auf der Gewinnung der Fasern liegt.
Bei mir
sind nun noch einige neue Geräte in Planung, um der Leinenherstellung
im Spätmittelalter möglichst nahe zu kommen und weiter auszuprobieren,
was mit den mir bisher bekannten Verarbeitungsweisen möglich war.
1 Zeitglöcklein, Verlag Bibliographisches
Institut Leipzig
2 Pfarrkirche Saak, Österreich, Foto: Johann Jaritz
3, 4, 6 und 7 SLUB / Deutsche Fotothek, Müller und Sohn,
Datensatz: http://www.deutschefotothek.de/obj70700795,T.html
5 British Library, Royal 16 G V f. 56 Gaia
Caecilia
8 British Library, King's 9 ff. 4v-5 March
Literaturnachweise:
1 Flachs, Züchtung-Anbau-Verarbeitung, Dambroth/Seehuber
2 www.scinexx.de, Nähen mit Flachs schon vor 34.000 Jahren
3 u. 13 Terminologie der Hanf- und Flachskultur
in den frankoprovenzialischen Mundarten, Dr. Walter Gerig
4 Aus Flachs wird Leinen, H. Hagen/H. Tödter S.
25/26
5 Flachs, Züchtung-Anbau-Verarbeitung, Dambroth/Seehuber
6 Vom Flachs zum Leinen, Franz Carl Lipp
S. 9
7 Experimentelle Archäologie: Bilanz 2001
8 u. 15 Von Flachs zu Leinen in alter
Zeit, Marianne Fasse S. 29 u. 37
9 Waz hilfet ane sinne kunst?, Tomas Cramer S.127
10 Der mittelalterliche Leinwandhandel
in Norddeutschland, Hermann Hohls
11 Die Grabung Feddersen Wierde, Werner Haarnagel
12 Kein Flachs - Eine Flachsbreche und andere seltene Holzfunde aus Neu Pansow, Martin Seegschneider
14 Weibsbilder al Fresco, W. Wunderlich S.
53/54
16
Ein Buch von alten Farben, E. Ploss
17 Handbuch der Naturfarbstoffe, H. Schweppe S.86
weiterführende Literatur u.a.:
Vom Flachs zum Leinengarn, Brigitte Dörte Becker
Die Faserpflanze Flachs/Lein, Helga Heubach
Randgruppen der spätmittelalterlichen Gesellschaft, Bernd-Ulrich
Hergemüller
Die Zunft im Mittelalter, Sabine Heusinger
Lexikon des Mittelalters
Lied im deutschen Mittelalter, Verlag Institute of German Studies
Anfänge der Leinenindustrie des Bodenseegebietes, Hektor Ammann
Leinenerzeugung und Leinenabsatz im östlichen Mitteldeutschland zur
Zeit der Zunftkaufe, Gustav Aubin ; Arno Kunze
Leinwandgewerbe und Fernhandel der Stadt St. Gallen von den Anfängen
bis 1520, Hans Conrad Peyer
Deutschland und die Tuchindustrie Nordwesteuropas im
Mittelalter, Hektor Ammann
Das Konstanzer Leinengewerbe. I. Geschichte und Organisation und II.
Quellen, Friedrich Wielandt
Gründung, Kapazität und Eigentumsverhältnisse der Chemnitzer Bleiche
(1357 - 1471), Gerhard Heitz
Spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Leinengewebe aus Ausgrabungen
und Kirchenschätzen, Tidow/Jordan-Fahrbach
Fashion in the Age of the Black Prince: A Study of the Years 1340-1365,
Stella Mary Newton
weitere Abbildungen zur Leinenherstellung u.a.:
Katalog der Ausstellung „Aufbruch in die Gotik“
La miniatura gotica, Emma Pirani
Spinnen und Weben, Almut Bohnsack
Weibsbilder al Fresco, W. Wunderlich
Kalenderminiaturen der Stundenbücher, W. Hansen









 In einem Buch aus dem letzten Jahrhundert habe ich noch
eine andere Art der Samenernte
kennengelernt.(4) In
einer Region im Elbe-Weser- Dreieck wurden die
Flachsstängel gegen eine niedrige Holzwand (Ausschlagebock)
ausgeschlagen. Wie effektiv diese Methode ist, kann ich nicht
sagen.
Es bleibt offen, ob diese Anwendung im Mittelalter in einigen Regionen
auch vorkam. Da kein Werkzeug nötig ist, vereinfacht es die Sache
natürlich.
In einem Buch aus dem letzten Jahrhundert habe ich noch
eine andere Art der Samenernte
kennengelernt.(4) In
einer Region im Elbe-Weser- Dreieck wurden die
Flachsstängel gegen eine niedrige Holzwand (Ausschlagebock)
ausgeschlagen. Wie effektiv diese Methode ist, kann ich nicht
sagen.
Es bleibt offen, ob diese Anwendung im Mittelalter in einigen Regionen
auch vorkam. Da kein Werkzeug nötig ist, vereinfacht es die Sache
natürlich.








 Darren
Darren Mein
Holzknüppel ähnelt diesem und einem Fund aus Bergen (Bryggen),
der
ebenfalls diesem Arbeitsgang zugeordnet und auf das Spätmittelalter
datiert wurde. In einem Text von Gottfried von Neifen taucht
der
Satz „si kann beidiu dehsen unde swingen“, Lied II, 5 1-3 auf.(9)
Hierbei frage ich mich,
ob das Wort „deshen“ auch für dreschen/brechen stehen könnte
und damit
diesen Arbeitsgang beschreibt. Da die Entstehungszeit und Verbreitung der Flachsbreche, wie wir sie heute
kennen nicht ganz sicher scheint, besteht für mich durchaus
die Möglichkeit, dass die Stängel nur durch das Klopfen gebrochen wurden. Ich habe das selber einmal ausprobiert
und es funktioniert tatsächlich. Allerdings muss man hier einschränken,
dass die Stiele hauptsächlich längs aufgespalten werden und die Arbeit
so wesentlich länger dauert. Auch ist nicht auszuschließen, dass
dadurch die Faser leidet.
Mein
Holzknüppel ähnelt diesem und einem Fund aus Bergen (Bryggen),
der
ebenfalls diesem Arbeitsgang zugeordnet und auf das Spätmittelalter
datiert wurde. In einem Text von Gottfried von Neifen taucht
der
Satz „si kann beidiu dehsen unde swingen“, Lied II, 5 1-3 auf.(9)
Hierbei frage ich mich,
ob das Wort „deshen“ auch für dreschen/brechen stehen könnte
und damit
diesen Arbeitsgang beschreibt. Da die Entstehungszeit und Verbreitung der Flachsbreche, wie wir sie heute
kennen nicht ganz sicher scheint, besteht für mich durchaus
die Möglichkeit, dass die Stängel nur durch das Klopfen gebrochen wurden. Ich habe das selber einmal ausprobiert
und es funktioniert tatsächlich. Allerdings muss man hier einschränken,
dass die Stiele hauptsächlich längs aufgespalten werden und die Arbeit
so wesentlich länger dauert. Auch ist nicht auszuschließen, dass
dadurch die Faser leidet.




 Belegt ist ebenfalls unser Schwingschwert. Das Original haben wir bei der
Ausstellung „Aufbruch in die Gotik“ in Magdeburg gesehen, es war eine
Leihgabe
des Braunschweiger Museums und wurde auf um 1250 datiert. Wir haben das
Schwert nach den angegebenen
Maßen im Ausstellungskatalog ebenfalls aus Rotbuche nachgebaut.
Belegt ist ebenfalls unser Schwingschwert. Das Original haben wir bei der
Ausstellung „Aufbruch in die Gotik“ in Magdeburg gesehen, es war eine
Leihgabe
des Braunschweiger Museums und wurde auf um 1250 datiert. Wir haben das
Schwert nach den angegebenen
Maßen im Ausstellungskatalog ebenfalls aus Rotbuche nachgebaut.

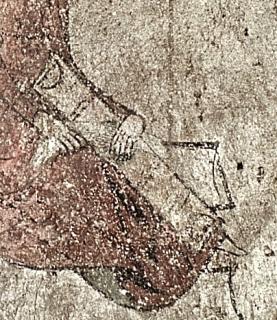

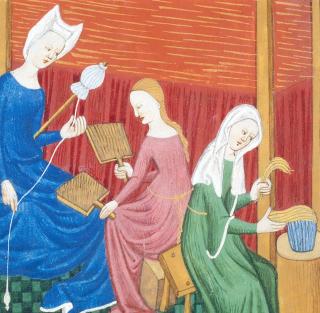


 Meine erste selbstgewonnene Faser 2015 von der Aussaat angefangen.
Eigentlich sollte ein Faseranteil von etwa zehn Prozent vom Flachsstroh
herauskommen. Bei mir war es wohl maximal die Hälfte gewesen.
Dennoch war ich sehr zufrieden mit dem ersten Ergebnis.
Meine erste selbstgewonnene Faser 2015 von der Aussaat angefangen.
Eigentlich sollte ein Faseranteil von etwa zehn Prozent vom Flachsstroh
herauskommen. Bei mir war es wohl maximal die Hälfte gewesen.
Dennoch war ich sehr zufrieden mit dem ersten Ergebnis.